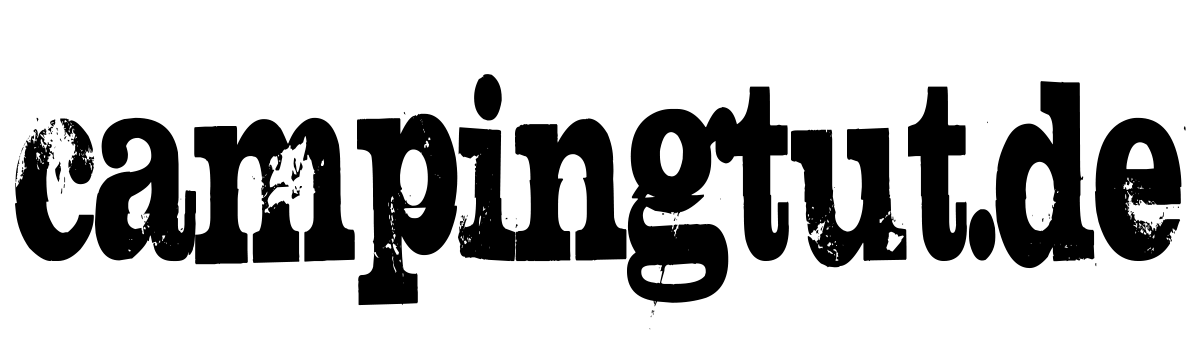Gewalttaten und Terroranschläge schockieren und sind oft schwer nachvollziehbar. Die negativen Auswirkungen und hohen Kosten solcher aggressiven Verhaltensweisen stellen ein großes gesellschaftliches Problem dar. Aggression und mangelnde Impulskontrolle sind jedoch keine Phänomene, die nur bei Gewalttätern auftreten. Tatsächlich reagieren fast alle Menschen aggressiv auf soziale Provokationen. Dennoch unterscheiden sich Menschen darin, wie gut sie ihre Impulse kontrollieren können oder ob sie aggressives Verhalten unterdrücken können, wenn sie provoziert werden.
Aggression wird in der Forschung oft als Verhalten definiert, das darauf abzielt, jemandem Schaden zuzufügen. Dabei unterscheidet man normalerweise zwischen reaktiver Aggression, die impulsiv, feindselig und emotional ist, und instrumenteller Aggression, die gezielt, emotionslos und rational ist. Impulsivität bezieht sich auf die Neigung, ohne Überlegung, Planung oder Berücksichtigung von Konsequenzen zu handeln. Menschen mit psychischen Erkrankungen neigen häufig zu mangelnder Impulskontrolle und Aggression, was ihre soziale Integration und erfolgreiche Behandlung behindern kann. Neurowissenschaftliche Forschung hat bereits gezeigt, dass solche dysfunktionalen Verhaltensweisen mit veränderten Aktivitäten im Gehirn zusammenhängen. Allerdings sind Aggression und Impulsivität komplexe Phänomene mit vielfältigen Ursachen, deren neurobiologische Grundlagen noch weitgehend unbekannt sind.
Im Rahmen der Jülich Aachen Research Alliance (JARA) haben Wissenschaftler der RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich das internationale Graduiertenkolleg “Neuronale Grundlagen der Modulation von Aggression und Impulsivität im Rahmen von Psychopathologie” ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Vertretern der University of Pennsylvania erforschen sie zentralnervöse und insbesondere neurobiologische Mechanismen von pathologischer Aggression und Impulsivität.
Die Forscher kombinieren bildgebende Verfahren und Verhaltensforschung mit neuropsychologischen, elektrophysiologischen, neuroendokrinen und molekularen Ansätzen, um die neurobiologischen Prozesse zu entschlüsseln. Da Aggression eine evolutionäre Funktion hat und ein Teil unseres Verhaltensmusters und unserer Emotionen ist, ist es auch interessant zu verstehen, wie sie kontrolliert und reguliert werden kann. Das Ziel der Forschung im Graduiertenkolleg ist daher auch die Entwicklung von Interventionen, um solches Verhalten erfolgreich zu reduzieren. In verschiedenen Projekten werden Fragen zum Einfluss von Persönlichkeit, Geschlecht und Genetik auf aggressives und impulsives Verhalten sowie zu den zugrunde liegenden neuronalen Netzwerken untersucht. Andere Projekte versuchen Verhalten durch neuromodulatorische, pharmakologische oder psychologische Methoden zu modulieren.
Erste Ergebnisse betonen den Einfluss von Genen und Hormonen auf aggressives Verhalten. Zum Beispiel zeigte sich, dass Menschen, die eine bestimmte Variante des Opioidrezeptor-Gens haben (das G-Allel anstelle des A-Allels), nach eigener Aussage weniger körperlich aggressiv sind und insgesamt weniger Aggressionen in einem provokativen Kontext zeigen. Bei diesen Personen wurde auch eine höhere Aktivierung in bestimmten Hirnregionen beobachtet, insbesondere im frontalen Hirnbereich, der Insel und dem anterioren cingulären Kortex, wenn sie sich für oder gegen eine aggressive Handlung entschieden.
Auch das Monoaminoxidase-A-Gen, das die Aktivität von Enzymen beeinflusst, die den Abbau von Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin steuern, erwies sich als relevanter Faktor. Interessanterweise deuteten die Ergebnisse auf eine Interaktion mit dem männlichen Sexualhormon Testosteron hin. Je nachdem, welche Varianten Personen trugen, die die Aktivität des Enzyms erhöhten oder verringerten, erhöhte oder verringerte zugeführtes Testosteron die Risikobereitschaft und den Ärger bei sozialer Provokation. Der Zusammenhang zwischen Testosteron und Aggression wurde bisher hauptsächlich durch Studien an Tieren belegt. In verschiedenen Laborexperimenten, bei denen Männer Testosterongel oder ein Placebo erhielten, konnte nachgewiesen werden, dass das Hormon auch beim Menschen einen Einfluss auf Emotionen und Motivation in situationsbedingten Provokationen hat. Nach der Verabreichung von Testosteron reagierten Männer mutiger auf potenziell bedrohliche Personen, wenn sie frei wählen konnten, wie nahe oder weit der Wohlfühlabstand ist. Testosteron verstärkte auch den Ärger in Frustrationssituationen. Interessanterweise passten sich Männer nach der Verabreichung von Testosteron stärker den Reaktionen eines Gegners an. Sie reagierten aggressiver auf sehr provokante Gegner und ähnlich wenig aggressiv auf wenig provokante Gegner. Dies scheint mit einer Aktivitätsänderung im sogenannten “Mentalizing Network” im Gehirn zusammenzuhängen, das an Perspektivenübernahme und dem Verständnis der Absichten anderer beteiligt ist und somit auch an der Entscheidung für aggressives oder nicht aggressives Verhalten.
Andere Projekte untersuchen Mechanismen im Verhalten und Gehirn, die bei psychisch erkrankten Personen und besonders aggressiven Gruppen wie Gewalttätern verändert sein könnten. Bei männlichen Gewalttätern deutet sich strukturell an, dass gesteigertes antisoziales Verhalten und reaktive Aggression mit Gewebeschwund im rechten mittleren und superioren temporalen Kortex einhergehen. Weitere Projekte im Graduiertenkolleg untersuchen die Auswirkungen von Neurostimulation auf Verhalten und Gehirnaktivität. Beispielsweise kann Neurofeedback oder transkranielle Gleichstromstimulation eingesetzt werden. Beim Neurofeedback lernen Personen durch gezieltes Feedback, die Aktivierung bestimmter Hirnregionen zu regulieren. Durch verbesserte Kontrolle der Hirnaktivierung in Regionen, die für die Regulation von Ärger oder die Hemmung negativer Handlungsimpulse relevant sind, kann auch das Verhalten beeinflusst werden. Negative Emotionen könnten besser reguliert und aggressive Impulse besser unterdrückt werden. Dies ist wichtig für Patienten mit psychischen Störungen, die Beeinträchtigungen in der Selbstregulation zeigen. In ersten Studien konnte die Methode bereits erfolgreich bei schizophrenen Patienten und solchen mit posttraumatischer Belastungsstörung angewendet werden. Bei letzteren wurde der anteriore cinguläre Kortex trainiert, um die Aktivität zu erhöhen. Eine schlechtere Fähigkeit zur Selbstregulation ging dabei mit einer höheren Psychopathologie und verschiedenen Krankheitssymptomen einher.
Ähnlich wirkt die Gleichstromstimulation durch die Veränderung der Hirnaktivierung auf Symptome oder Verhaltensprozesse. Wichtige Hirnregionen, die die Handlungs- und Emotionskontrolle unterstützen, befinden sich im vorderen Teil des Gehirns. Durch die gezielte Anwendung eines geringen elektrischen Stroms durch Elektroden an der Schläfe kann die kortikale Erregbarkeit verändert werden. Der Mechanismus beruht auf einer Veränderung des Ruhepotenzials, wodurch die Wahrscheinlichkeit spontaner Aktivierungen bestimmter Neuronen erhöht oder verringert wird. Ähnlich wie beim Neurofeedback können durch die Modulation verschiedener Hirnregionen Veränderungen erreicht werden, die aggressives und impulsives Verhalten reduzieren könnten. Diese Methode wurde nicht nur bei gesunden Probanden, sondern auch bei verschiedenen Patientengruppen mit dem Ziel einer Verbesserung psychopathologischer Symptome eingesetzt. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hemmungskontrolle bei Suchtpatienten und das Lernverhalten bei Gewalttätern erfolgreich verbessert werden können.
Auch die translationale Forschung wird unterstützt. Durch Tiermodelle können Fragen zur Aggression untersucht werden, die dazu beitragen, die molekulare Ebene besser zu verstehen. Im Tierreich ist bekannt, dass das olfaktorische System bei territorieller Aggression eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere das Jacobs-Organ ermöglicht männlichen Mäusen die Identifizierung von Pheromonen und sekundären Steroidhormonen, die verschiedene Formen sozialer Aggression auslösen. Diese Forschung könnte auch beim Menschen Erkenntnisse zur territorialen Aggression, beispielsweise im Hinblick auf männliche Rivalität im Paarungsverhalten, liefern. In Zukunft sollen vermehrt große Datensätze genutzt werden, die in nationalen und internationalen Datenbanken verfügbar sind. Mit ihrer Hilfe können potenzielle Biomarker für Aggression und Impulsivität identifiziert und in experimentellen Designs getestet werden. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass die Verbindung zwischen Darm und Gehirn vorhersagen kann, wie gut aggressive Impulse in Stresssituationen unterdrückt werden können. In weiteren Studien könnten dann gezielt diese Verbindungen zwischen Darm und Gehirn manipuliert werden, um kausale Zusammenhänge zu testen. Langfristig könnten daraus auch therapeutische Ansätze für Hochrisikogruppen abgeleitet werden. Die Kombination von großen Datensätzen, die neue Fragestellungen für experimentelle Designs liefern, ist besonders wichtig, da nur in solchen Datensets zuverlässige Merkmale identifiziert werden können und in der Regel eine größere Anzahl von Einflussfaktoren erfasst wird, die letztendlich relevant sein könnten. Dafür werden auch neue methodische Ansätze eingesetzt, die für multidimensionale Datensätze geeignet sind. Dadurch besteht die Hoffnung, neue therapeutische und diagnostische Ansätze zu entwickeln.
Dieser Artikel stützt sich auf das Forschungsmagazin RWTH THEMEN.