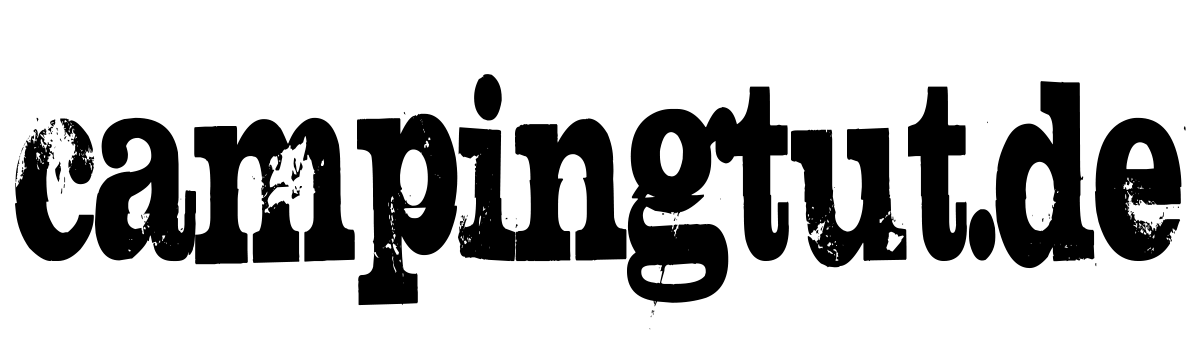Die Berliner Maueröffnung im November 1989 war der spektakuläre Höhepunkt der dritten Welle der Demokratie nach Samuel Huntington. Bilder von Menschenmassen, die die Grenzkontrollen überwinden und von ihren westdeutschen Mitbürgern euphorisch empfangen werden, symbolisierten nicht nur den Triumph des Volkes über ihr unterdrückendes Regime, sondern auch letztendlich den Sieg des westlichen Wirtschaftsliberalismus, der für Wissenschaftler wie Huntington und Francis Fukuyama mit Demokratie gleichgesetzt wurde. Fukuyama bezeichnete in seinem bekannten Artikel “Das Ende der Geschichte” aus dem Sommer 1989 den materiellen Überfluss als entscheidend für den Erfolg der liberalen Demokratie oder als “die letzte Form der menschlichen Regierung”. Er erklärte, dass der Gehalt des universellen homogenen Staates aus liberaler Demokratie im politischen Bereich in Verbindung mit leichtem Zugang zu Videorecordern und Stereoanlagen im wirtschaftlichen Bereich besteht. In den Tagen, Wochen und Monaten nach der Maueröffnung beherrschte der Zugang zur Konsumkultur die Diskussionen über Befreiung. Vom 100-Deutschmark-Begrüßungsgeld für Erstbesucher der Bundesrepublik aus der DDR, das endloses Medienfutter über den Massenansturm ostdeutscher Bürger auf westdeutsche Geschäfte lieferte, bis hin zu Bundeskanzler Helmut Kohls Versprechen, dass die Vereinigung mit der Bundesrepublik die ehemaligen DDR-Provinzen in “blühende Landschaften” verwandeln würde, in denen es sich lohnt zu leben und zu arbeiten. Die postsozialistische Demokratie, die den Ostdeutschen präsentiert wurde, hatte Verbraucherkultur als Kernpunkt. Die Ostdeutschen sollten die leeren Regale des Sozialismus hinter sich lassen und, wie Daphne Berdahl beschreibt, zu “Bürger-Konsumenten” transformiert werden.
Die rasche Veränderung von Sozialismus zu Kapitalismus
Der Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus verlief rasch. Bei den ersten freien Wahlen der DDR am 18. März 1990 stimmte eine große Mehrheit der Wähler (48,1%) für die von Westdeutschland unterstützte Koalition “Allianz für Deutschland”. Diese lief unter dem Motto “Nie wieder Sozialismus” und setzte sich für eine schnelle deutsche Wiedervereinigung und privates Eigentum ein. Dieses Ergebnis setzte eine rasche Kette von Ereignissen in Gang, darunter die Einführung der Westdeutschen D-Mark in der DDR durch die Währungsunion am 1. Juli, die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober und den anschließenden Austausch der Strukturen, Systeme und Institutionen der DDR gegen die der Bundesrepublik. Berlin diente als Aushängeschild für dieses schnelle Tempo des Wandels. Während Entwickler sich beeilten, aus den früheren Brachflächen, die die Mauer umgeben hatten, zu profitieren und die Topografien der einst getrennten Stadt zu einer umfangreichen kulturellen und administrativen Mitte verschmolzen, begann Berlin, der westlichen Vorstellung von Wiedervereinigung eine physische Form zu geben. Die physische Transformation wurde auch in der schnellen Demografieüberholung der Kultur- und Geistesinstitutionen von Ost-Berlin repliziert. Westdeutsche Professoren wurden beispielsweise 1990 eingestellt, um die Humboldt-Universität auf der Unter den Linden zu restrukturieren, als Teil einer umfassenden Reform der ostdeutschen Universitäten, und ostdeutsche Akademiker mussten sich erneut bewerben, viele ohne Erfolg. In der ehemaligen Staatsoper der DDR, auf der anderen Straßenseite vom Humboldt, wurde 1991 ein neuer Manager namens Georg Quander ernannt, der zuvor als Musikdirektor für das von den USA geförderte RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor/Radio im amerikanischen Sektor) in West-Berlin tätig war.
Die langsameren Veränderungen außerhalb des Zentrums
Abseits des Stadtzentrums vollzog sich die Westerisierung langsamer. Die heruntergekommenen Mietshäuser und verlassenen Gebäude, die sich von Berlin Mitte aus in Richtung Prenzlauer Berg und Friedrichshain erstreckten, waren Sinnbild für die finanzielle Bankrotterklärung des DDR-Regimes. Sie boten auch Raum für reformsozialistische Gruppen – Künstler, Intellektuelle und Gegenkulturen -, die in den letzten Jahren der DDR politische Veränderungen gefordert hatten, um alternative ostdeutsche Zukünfte zu artikulieren, in denen die DDR nicht einfach dem Westen angepasst wurde. Die Reformsozialisten fanden es schwer zu akzeptieren, mit welcher Begeisterung ihre Mitbürger die Westerisierung und den Konsumismus annahmen. In einem Artikel für den Spiegel im Dezember 1989 verurteilte der Schriftsteller Stefan Heym die Geschwindigkeit, mit der seine Landsleute sich von einem Volk, das “aufgestanden war und sein Schicksal in die eigenen Hände genommen hatte” und das “vor kurzem noch nobel in eine vielversprechende Zukunft zu marschieren schien”, in eine “Schar von frenetischen Käufern” verwandelt hatten, die mit “kannibalistischer Lust” über westdeutsche Kaufhäuser herfielen, auf der Suche nach nutzlosem Trödel. Heyms Verachtung fand einen praktischen Ausdruck in der interventionistischen Performance-Veranstaltung, die das antikapitalistische Eimer-Musikkollektiv am 14. April 1990 in der Rosenthaler Straße in Berlin Mitte inszenierte. Das Kollektiv, das von Mitgliedern der ostdeutschen Alternative-Bands IchFunktion, Freygang und Die Firma geleitet wurde, kündigte die Veranstaltung über Flugblätter, Plakate und Zeitungsanzeigen an, auf denen stand: “Wir wollen Westler sein!!! Am Samstag, den 14.4.1990 um 17.00 Uhr 5.000 DM unter den Leuten. Wer Westgeld mag, sollte kommen!” Am Tag selbst versammelten sich rund 500 Menschen, einige mit leeren Taschen und umgestülpten Regenschirmen, auf der Straße vor dem Eimer, einem seit Monaten von dem Kollektiv besetzten verlassenen Gebäude. Um 17 Uhr trat ein Mann auf dem Dach eines Gebäudes gegenüber dem Eimer auf und begann, Münzen hinunterzuwerfen. Anstelle der angekündigten 5.000 DM verteilte er jedoch nur eine Handvoll Ein- und Zwei-Pfennig-Münzen und forderte die Menge auf, “Wir wollen Westler sein!” zu rufen, um mehr Geld zu bekommen. Einige kamen der Aufforderung nach und wurden mit einer weiteren Handvoll Münzen belohnt. Sebastian Mönning schrieb in der Telegraph über die Menge: “Wer das sah und hörte, musste sich schämen, ein “Ostdeutscher” zu sein (zumindest ging es mir so).”
Musikalisches Schaffen in Ost-Berlin nach der Wende
Für die verschiedenen und oft spezialisierten musikalischen Gemeinschaften im Ost-Berlin bot die noch unveränderte Klanglandschaft der DDR die Möglichkeit, ostdeutsche Identitäten auf eigene Weise neu zu verhandeln. Ein Beispiel dafür ist das Punkkonzert, das in Petra Tschörtners Dokumentation “Berlin Prenzlauer Berg – Begegnungen zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990” festgehalten wurde. Das Konzert fand am 30. Juni, am Vorabend der Währungsunion, im Franz-Club (heute Frannz Club in der Kulturbrauerei) statt und beinhaltete eine satirische Beerdigung der Ostmark, der ehemaligen DDR-Währung. Als um Mitternacht eine Glocke läutete, übernahmen drei Blechbläser in T-Shirts und Jeans die Bühne und spielten eine feierliche Version der Nationalhymne der DDR “Auferstanden aus Ruinen”. Der Schlagzeuger der Band parodierte die Rhythmen einer Militärtrommelkapelle, der Sänger mimte den Dirigenten und ein Mädchen mit Clown-Makeup hielt Funkenstäbe vor der Bühne hoch. Während die Menge pfiff und einige Paare in übertriebener Weise langsam tanzten, wurde die Darbietung der Hymne zunehmend verzerrt, und das Clown-Mädchen warf eine umgedrehte Regenschirm voller DDR-Münzen in die Menge. Die Hymne endete in einer dissonanten und alles andere als zeremoniellen Art und Weise, ein passendes Ende für den DDR-Staat. Es folgte jedoch die Möglichkeit eines Neuanfangs, als die Band eine laute Version des Liedes “Sag mir, wo du stehst” anstimmte, zu der die Menge mitsprang und mitschrie. Der Song “Sag mir, wo du stehst” wurde 1966 von Hartmut König geschrieben und stand für die Strukturen der Staatsmacht. Es war die inoffizielle Hymne der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und ein fester Bestandteil des ostdeutschen Schulcurriculums. Die Lyrics sind nicht subtil; wie David Robb bemerkt, gibt es keine Verwechslung mit der Parteirhetorik, den versteckten Verweisen auf den “Klassenfeind” und der Haltung “entweder mit uns oder gegen uns”. Die unorthodoxe Darbietung im Franz-Club bedeutete eine klare Ablehnung dieser Spaltungs-Ideologie; die ungebremste Begeisterung, mit der die Menge das Lied in Besitz nahm, deutete jedoch auch darauf hin, dass die jüngste ostdeutsche Vergangenheit für diese Gruppe etwas war, das zurückgewonnen werden könnte, anstatt weggeworfen zu werden.
Die Rolle, die Musik bei der Beschwörung sozialistischer Demokratien spielen könnte, war keineswegs einfach. Das utopische Potenzial, das der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zunächst inder westlichen Kunstmusik und dem politischen Lied der frühen DDR zugeschrieben wurde, hatte sich nicht materialisiert, und die oppositionelle Ästhetik, die sich in den 1970er Jahren entwickelt hatte, beschäftigte sich größtenteils mit der Kritik an bestehenden Systemen und nicht mit der Entwicklung neuer. Mit dem Verschwinden des SED-Regimes sahen sich Musiker – von Komponisten der Kunstmusik bis zu Punks – mit dem Verlust ästhetischer Funktionen konfrontiert. Reiner Bredemeyer hatte sich im September 1989 als “Komponist, der prinzipiell in die “Situation” eingreifen will und muss” bezeichnet, wobei die Situation die aktuellen Angelegenheiten der DDR waren, die häufig in seinen eiligen, aktuellen Werken behandelt wurden. Aber 1992 beklagte er, dass es nun “überhaupt keinen Spaß mehr machte, sich einzumischen”, und erklärte, dass “man nicht einmal dagegen sein kann… – niemanden interessiert das. Sie werden nicht mehr wütend, alles wird durch Geld geregelt.” Auch die Liedermacher und Kabarett-Künstler der DDR hatten Schwierigkeiten. Sie hatten sich in den 1970er und 1980er Jahren als Nachrichtenüberbringer positioniert, als Wahrheitssager in einem Klima der Zensur. Bettina Wegner erklärte 1992, dass sie und ihre Kollegen Liedermacher in der DDR ein “Ersatz für die Presse” waren. Aber sie fügte hinzu: “Wenn es keine Pressezensur gibt, braucht man diese Songs nicht mehr zu schreiben.”
Musik als Quelle der Veränderung
Um die Unsicherheit der 1990er Jahre darüber zu überwinden, wie und ob Musik als Agent des Wandels dienen könnte, war es wichtig, die Funktion zu beachten, die Musik in der DDR hatte, um unterschiedliche Gemeinschaften zusammenzubringen und spezifische Identitäten und soziopolitische Werte zu prägen. Die Zerschlagung der staatlichen Strukturen hatte zur Dezimierung einiger dieser Gemeinschaften geführt – die DDR-Komponistengemeinschaft zum Beispiel hatte mit dem Rückgang von Aufträgen und Aufführungsmöglichkeiten zu kämpfen. Für andere bot die Öffnung in Ost-Berlin Anfang der 1990er Jahre jedoch die einzigartige Möglichkeit, die Ideale, die ihrer Musik zugrunde lagen, neu zu konzipieren und zu überdenken, um neue antikapitalistische Welten zu schaffen. Im Folgenden werde ich zwei solcher Versuche zur Neugestaltung betrachten: zunächst kurz die Schaffung autonomer kreativer “Staaten” im ostdeutschen Osten durch Mitglieder der alternativen Bands der DDR, und dann ausführlicher die Artikulation der DDR als Teil einer breiteren sozialistischen, musikalisch verbundenen Welt durch diejenigen, die in der politischen Liedbewegung der DDR engagiert waren. Ich werde nicht ihre musikalischen Ausgaben, sondern vielmehr betrachten, wie sie das politische Potenzial der Identitäten und Praktiken, die sie in der DDR definierten, umwidmeten und neu verhandelten.