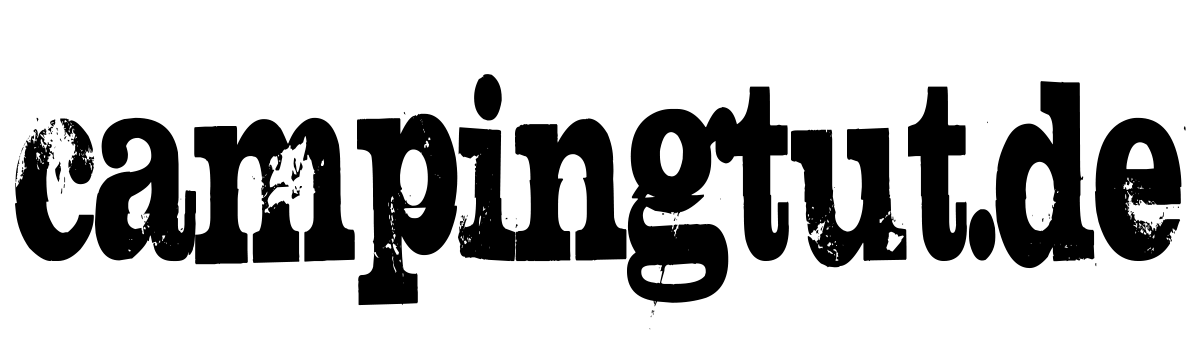Es steht ein pinker Cadillac vor dem Theater. Daneben steht ein Mann mit zurückgegelten Haaren wie eine Statue. Viele andere stehen in derselben Pose, darunter auch viele kleine Kinder. Ihre Haare sind zurückgegelt, sie tragen enge, mit Juwelen besetzte weiße Outfits. Ein Junge steht im Cadillac und streckt seine Hände wie Hörner in den Himmel.
Es gibt keine Popkulturfigur, die so lange überdauert wie Elvis Presley – es gibt einen Grund, warum er der meistimitierte Prominente aller Zeiten ist – etwas, das in der Eröffnungsnacht von Elvis: Die musikalische Revolution in Melbourne bestätigt wird.
Mit Nostalgie oder Fluchtgedanken im Hinterkopf versucht das offizielle Jukebox-Bio-Musical, das von Alister Smith inszeniert wurde und im August in Sydney Weltpremiere hatte, die Starpower des Mannes, der als König des Rock’n’Roll bekannt ist, einzufangen. Es gibt auch Einblicke in seine problematische Psyche kurz vor dem berühmten “68 Comeback Special”.
Die Ergebnisse sind gemischt. Als Presley hat Rob Mallett die Bewegungen perfekt drauf und eine anständige Stimmreichweite. Er hat sichtlich Spaß daran, sich in Silhouette zu präsentieren und die Bühne mit Selbstbewusstsein zu betreten. Die Musik ist erwartungsgemäß ausgezeichnet und wird von einer großartigen Band begleitet. Allerdings entsteht dadurch ein unmittelbarer und potenziell nachteiliger Vergleichspunkt zu den Originalen, und die Versuchung, so viele Hits wie möglich unterzubringen, ist möglicherweise stark genug, um die Laufzeit aufzublähen und die Show um mindestens eine halbe Stunde zu lang zu machen.
Es ist ein visuelles Spektakel: Das Bühnenbild von Dan Potra ist von hellen Lichtern umrahmt und oft in zwei Ebenen aufgeteilt, um den Look und das Feeling eines Fernsehstudios oder Musikvideos nachzuahmen. Zeitweise wirkt es jedoch wie ein polierter Beitrag zu einem Rock-Eisteddfod. Die bunte und fröhliche Kostümgestaltung von Isaac Lummis erinnert an andere zeitgenössische Werke wie “Hairspray”, “Grease” oder sogar “Zurück in die Zukunft”. Es werden auch einige von Presleys ikonischsten Looks, wie der weiße Schlaghosen-Jumpsuit, nachgebildet.
Crucially, the book by American writers Sean Cercone and David Abbinanti is largely uninspired and slightly messy, hinging on a toothless “follow your dreams” trajectory through an ambitious vertical narrative that jumps back and forward in time. Presley’s child self – a role shared by four young actors, but played on opening night by confident and charming 12-year-old Daniel Lim – appears as a Jiminy Cricket-style conscience at a moment of crisis, and is often watching from above as his adult self performs.
It’s naff and saccharine but does allow for some touching moments: Presley’s relationship with his mother Gladys, played by Noni McCallum, is beautifully rendered, particularly in a scene where the child hears his mother sing the American Civil War song Aura Lea and the audience sees it evolve into one of his best-known hits, Love Me Tender. McCallum has lovely chemistry with Mallett and Lim onstage.
A full company a cappella rendition of Peace in the Valley, marking Gladys’ death and closing the first act, has some of the best vocal arrangements in the show, though there’s some flatness to the pitch. Other songs are used to lesser effect, such as Presley singing Can’t Help Falling in Love to his newborn baby, which is one of the show’s cringiest moments.
Some of Presley’s less savoury actions are surprisingly touched on, including his abusive treatment of his romantic partners and musical colleagues – the latter in a stop-start performance of Hard-Headed Woman that shows the arrogance that had overtaken the once earnest Presley.
Considering that the writers have elected to include this side of Presley’s character, it’s especially interesting what is only skirted past. The spectre of cultural appropriation hangs thick in the air; having grown up in the poor Black neighbourhood of Tupelo, he was inspired by the culture around him, and while it’s briefly mentioned (and Joti Gore and Jo-Anne Jackson steal the show as influences Roy Brown and Sister Rosetta Tharpe), a tension remains.
As with much Presley media, the fact that his wife Priscilla Beaulieu was just 14 to his 24 when they met is not mentioned, nor does Annie Chiswell play the character in a way that reflects the age gap. Such uncomfortable truths are often omitted – and it begs the question of whether it’s really an honest portrayal of a life when its darkest contours are scribbled out.
The jukebox musical is, ultimately, a vessel for beloved songs – perhaps to expect much more is a misalignment of goals. As a celebration of Presley’s music, Elvis: A Musical Revolution is joyful and fun, but I’m unconvinced it offers much more than going to a very good tribute show. As something deeper, it aims high and misses.
Elvis: Die musikalische Revolution ist bis zum 26. November im Athenaeum Theatre in Melbourne zu sehen.