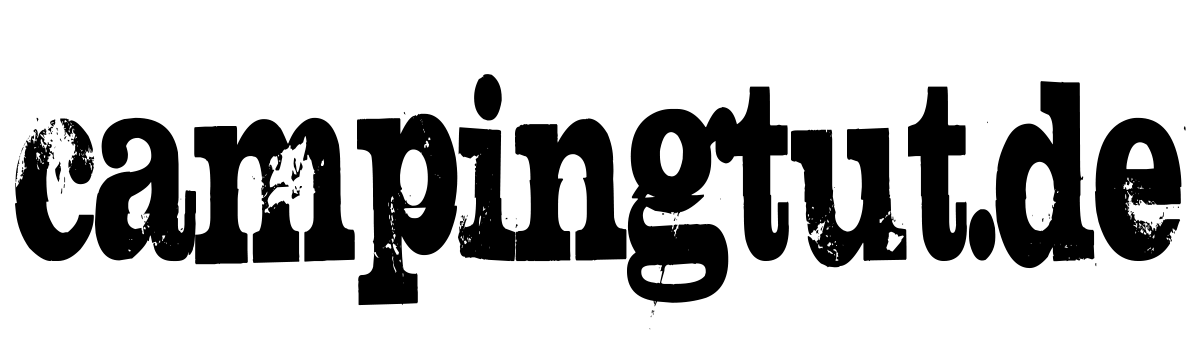Unter den weit verbreiteten Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Bereich der Emotionen ist die erhöhte Anfälligkeit von Frauen für die Entwicklung affektiver Störungen, insbesondere Depression und Angst (vgl. Nolen-Hoeksema, 2001; Kessler et al., 2007; Steel et al., 2014), besonders prominent. Im Laufe der Jahre wurde diese weibliche Anfälligkeit für depressive Symptome einerseits auf eine erhöhte emotionale Reaktivität gegenüber negativen Reizen zurückgeführt (Bradley et al., 2001; Kessler, 2003; Kelly et al., 2008), andererseits jedoch auch auf potenziell ungünstige Emotionsregulation (z.B. Garnefski et al., 2004; Nolen-Hoeksema, 2012), sowohl im Verhalten als auch auf der Ebene des Gehirns (z.B. Domes et al., 2010; Whittle et al., 2011; Stevens und Hamann, 2012). Dennoch sind konsistente empirische Belege für Geschlechtsunterschiede, insbesondere in der Emotionsregulation, die wiederum Geschlechtsunterschiede in verschiedenen Arten von psychopathologischen Störungen erklären könnten, rar (siehe Nolen-Hoeksema und Aldao, 2011; Whittle et al., 2011; Zimmermann und Iwanski, 2014). Dies, zusammen mit der zunehmenden Erkenntnis, dass eine unzureichende Emotionsregulation das Kernproblem verschiedener Störungen darstellt (Martin und Dahlen, 2005; Aldao und Nolen-Hoeksema, 2010; Hofmann et al., 2012; Berking et al., 2014; Joormann und Stanton, 2016), verdeutlicht die Notwendigkeit für eingehendere Untersuchungen zu Geschlechtsunterschieden in der Fähigkeit zur Umsetzung bestimmter Emotionsregulationsstrategien.
Eine Emotionsregulationsstrategie, die in diesem Fall besondere Beachtung verdient, ist die kognitive Umdeutung. Kognitive Umdeutung zielt darauf ab, den emotionalen Einfluss einer Situation zu verändern, indem sie bewusst aus einer anderen Perspektive betrachtet wird, indem alternative situative Interpretationen verwendet werden (z.B. Lazarus und Alfert, 1964; Lazarus und Folkman, 1984; Gross und John, 2003). Übereinstimmende Ergebnisse aus mehreren Studien haben gezeigt, dass kognitive Umdeutung besonders effektiv ist, um mit belastenden Ereignissen umzugehen, negative Affekte nachhaltig zu regulieren und depressive Symptome zu verringern (z.B. Martin und Dahlen, 2005; Augustine und Hemenover, 2009; Troy et al., 2010; Webb et al., 2012). So fanden Martin und Dahlen (2005) heraus, dass unabhängig vom Geschlecht eine höhere selbstberichtete positive Umdeutung mit geringeren depressiven Symptomen einherging, während Troy et al. (2010) zeigten, dass kognitive Umdeutung vor depressiven Symptomen während stressiger Lebensereignisse schützte. Metaanalysen stützten diese Ergebnisse, wobei Augustine und Hemenover (2009) Verbindungen zwischen kognitiver Umdeutung und großen hedonischen Verschiebungen im Affekt (definiert als Abnahme negativer oder Zunahme positiver Emotionen und indexiert durch Selbstbericht) zeigten. Diese Ergebnisse wurden von der Metaanalyse von Webb et al. (2012) unterstützt, die zeigte, dass kognitive Umdeutung auch auf Verhaltens- und physiologischer Ebene sehr wirksam ist. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die höhere Prävalenz von Depressionen bei Frauen teilweise auf selteneren oder weniger effektiven Anwendung kognitiver Umdeutung beruhen könnte. Allerdings sind die verfügbaren Daten gemischt. Einige Studien zeigen, dass Frauen häufiger kognitive Umdeutungen verwenden als Männer (z.B. Tamres et al., 2002; Spaapen et al., 2014; auch siehe Nolen-Hoeksema, 2012), obwohl in der Metaanalyse von Tamres et al. (2002) dieser Effekt für die meisten Emotionsregulationsstrategien berichtet wurde. Diese Ergebnisse werden jedoch von anderen Studien herausgefordert, die keine Geschlechtsunterschiede in der regelmäßigen Verwendung kognitiver Umdeutungen zeigen (Gross und John, 2003; Haga et al., 2009; Zlomke und Hahn, 2010) oder sogar mehr positive Neubewertungen bei Männern feststellen (Öngen, 2010). Auch die Forschung zu geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Verwendung kognitiver Umdeutungen auf depressive Symptome während der Adoleszenz liefert unterschiedliche Ergebnisse: Entweder wird kognitive Umdeutung als ebenso wirksam angesehen, um depressive Symptome bei beiden Geschlechtern zu verringern (Shapero et al., 2018) oder es wird angenommen, dass ein stärkerer regelmäßiger Einsatz von kognitiven Umdeutungen bei Mädchen als bei Jungen zu einer stärkeren Verringerung von depressiven Symptomen führt (Duarte et al., 2015).
Eine mögliche Erklärung für diese widersprüchlichen Befunde könnte darin liegen, dass bisherige Studien sich hauptsächlich auf selbstberichtete Tendenzen zur Verwendung kognitiver Umdeutungen konzentriert haben und damit potenzielle Geschlechtsunterschiede in der tatsächlichen Fähigkeit, kognitive Umdeutungen in kritischen Situationen angemessen umzusetzen, vernachlässigt haben (z.B. Perchtold et al., 2018). Mehrere Forscher haben darauf hingewiesen, dass die typische Verwendung von kognitiver Umdeutung im täglichen Leben nicht mit der tatsächlichen Fähigkeit zur Umsetzung dieser Strategie bei Konfrontation mit belastenden Szenarien gleichgesetzt werden kann, da es keine oder nur schwache Korrelationen zwischen den beiden gibt (McRae et al., 2008; Troy et al., 2010; Weber et al., 2014). Trotz zahlreicher Forderungen nach objektiven Leistungsmessungen der tatsächlichen Emotionsregulationsfähigkeit von Individuen (Demaree et al., 2006; McRae et al., 2008; Whittle et al., 2011; Opitz et al., 2015) wurden bisher nur wenige Anstrengungen in diese Richtung unternommen. Daher bleiben Vermutungen, dass Männer und Frauen möglicherweise in ihrer grundlegenden Fähigkeit zur kognitiven Umdeutung unterschiedlich sind, bisher eher spekulativ. In dem Bemühen, etwas Klarheit in das Bild zu bringen, untersuchten zwei Studien zur Gehirnbildgebung (McRae et al., 2008; Domes et al., 2010) speziell Geschlechtsunterschiede in den neuronalen Korrelaten der instruierten kognitiven Umdeutung, mit unterschiedlichen Ergebnissen. McRae et al. (2008) berichteten über geringere Erhöhungen der präfrontalen Aktivität und größere Abnahmen der Amygdala-Aktivität während Bemühungen zur kognitiven Umdeutung bei Männern im Vergleich zu Frauen, trotz ähnlicher Verringerungen selbstberichteter negativer Emotionen bei beiden Geschlechtern. Domes et al. (2010) fanden ein ganz anderes Aktivierungsmuster, das auf eine größere präfrontale Aktivität bei Männern im Vergleich zu Frauen während der Umsetzung kognitiver Umdeutungen hinwies, wobei keine bemerkenswerten Geschlechtsunterschiede in der Amygdala-Aktivität oder im Selbstbericht von Regulationserfolg festgestellt wurden. Interessanterweise interpretierten beide Studien ihre Ergebnisse im Hinblick auf einen effizienteren Umdeutungsprozess bei Männern, der auf eine weniger anstrengende kognitive Kontrolle (McRae et al., 2008) und eine angemessenere Rekrutierung von regulatorischen Bereichen (Domes et al., 2010) bei Männern im Vergleich zu Frauen hindeutet. Obwohl dieses Argument eine kritische Beteiligung von exekutiven Kontrollprozessen an effektiver Umdeutung nahelegt (Joormann und Gotlib, 2010; Malooly et al., 2013; Pe et al., 2013; Rominger et al., 2018), verwendeten beide Studien keine objektiven Verhaltensindikatoren für die Umdeutungsfähigkeit, was es erschwert, ihre Ergebnisse in den Zusammenhang zu setzen. Insgesamt bleibt also die Frage offen, ob Männer und Frauen sich in ihrer grundlegenden Fähigkeit zur Umsetzung alternativer Bewertungen in kritischen Situationen unterscheiden.
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, diese Lücke in der Literatur zu schließen, indem sie Geschlechtsunterschiede in der grundlegenden Fähigkeit zur Generierung kognitiver Umdeutungen untersucht. Darüber hinaus untersuchte die Studie, wie diese Fähigkeit zu den depressiven Erfahrungen von Individuen im täglichen Leben in Beziehung steht. Genauer gesagt ging es darum festzustellen, ob die Fähigkeit zur kognitiven Umdeutung als Prädiktor für depressive Erfahrungen im täglichen Leben fungieren kann, unabhängig von der Selbstwirksamkeit bei der Emotionsregulation, und ob dies für beide Geschlechter in ähnlicher Weise gilt. In dieser Studie wurde der Reappraisal Inventiveness Test (RIT; Weber et al., 2014) verwendet, der Individuen mit selbstbezogenen bedrohlichen Situationen konfrontiert und sie anweist, so viele unterschiedliche kognitive Umdeutungen wie möglich zu generieren, um ihre erlebten Belastungen und Ängste abzubauen. Wichtig war, dass unser Fokus bei der Verwendung des RIT auf Geschlechtsunterschieden in der Umdeutungsfähigkeit im psychometrischen Sinne lag, d.h. inwieweit Männer und Frauen theoretisch in der Lage sind, kognitive Umdeutungen in belastenden Situationen umzusetzen (Maximalleistung, Cronbach, 1970). Die objektive Kodierung der Umdeutungsideen der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Angemessenheit (siehe Demaree et al., 2006) ergibt einen Index der Umdeutungsfähigkeit. Diese Fähigkeit kann als grundlegend oder fundamental bezeichnet werden, da sie das grundlegende kognitive Potenzial einer Person zur Konstruktion verschiedener Interpretationen in gegebenen Situationen umreißt (d.h. eine konstruktive Kompetenz), was eine größere Flexibilität im Umgang mit alltäglichen Herausforderungen ermöglicht (Weber et al., 2014). In diesem Zusammenhang haben Studien eine höhere Umdeutungsfähigkeit in kognitiver Umdeutung mit einer angemesseneren Rekrutierung des lateralen präfrontalen Kortex während der Bemühungen zur Emotionsregulation in Verbindung gebracht (Papousek et al., 2017), was auch die selbst wahrgenommenen chronischen Stressniveaus vorhersagte (Perchtold et al., 2018). Dies stützt die Annahme, dass diese gehirnbasierte Umdeutungsfähigkeit die Voraussetzung für eine effektive Umsetzung von Umdeutungen im täglichen Leben darstellt (Weber et al., 2014; de Assuncao et al., 2015; Papousek et al., 2017). Allerdings müssen hierbei zwei Dinge berücksichtigt werden. Erstens könnte es im täglichen Leben gelegentlich relevanter erscheinen, eine qualitativ hochwertige Umdeutung zu generieren, als eine Vielzahl unterschiedlicher Umdeutungen, um den emotionalen Einfluss belastender Situationen effektiv zu verringern. Dennoch kann argumentiert werden, dass die Fähigkeit, einen großen Pool potenzieller Umdeutungen für eine gegebene Situation zu generieren, es wahrscheinlicher macht, dass Individuen Umdeutungen auswählen können, die sie in diesem spezifischen Kontext effektiv umsetzen können (auch siehe Wisco und Nolen-Hoeksema, 2010). Über ein breites Repertoire potenzieller Umdeutungen zu verfügen, kann besonders relevant sein, wenn Individuen neuen Situationen gegenüberstehen, in denen sie sich nicht auf ihre üblichen Strategien verlassen können (Weber et al., 2014). Zweitens deckt die Umdeutungsfähigkeit, obwohl sie als wesentliche Voraussetzung für die effektive Umsetzung kognitiver Umdeutungen angesehen wird, nur einen bestimmten Aspekt im Umdeutungsprozess ab. Individuen müssen nicht nur grundsätzlich in der Lage sein, verschiedene situative Bewertungen zu konstruieren, sondern sie müssen diese Fähigkeit auch im täglichen Leben nutzen (Perchtold et al., 2018). Umgekehrt kann jedoch auch argumentiert werden, dass wenn die grundlegende Fähigkeit einer Person zur Generierung kognitiver Umdeutungen beeinträchtigt ist, der regelmäßige Einsatz von kognitiver Umdeutung im täglichen Leben keine Vorteile bringt und Umdeutungstrainings, z.B. in der kognitiven Verhaltenstherapie, möglicherweise nicht ausreichend wirksam sind.
Unseres Wissens nach wurde bislang keine Studie durchgeführt, um Geschlechtsunterschiede bei der expliziten Fähigkeit zur ad hoc-Generierung kognitiver Umdeutungen für belastende Situationen zu testen. Darüber hinaus hatten wir angesichts der widersprüchlichen Ergebnisse aus der Literatur zu Geschlechtsunterschieden in exekutiven Kontrollprozessen, die für die Emotionsregulation relevant sind (McRae et al., 2008; Domes et al., 2010; Franklin et al., 2018), keine starken a priori-Vorhersagen darüber, welches Geschlecht eine bessere Umdeutungsfähigkeit zeigen würde und wie diese Fähigkeit mit depressiven Symptomen bei Männern und Frauen zusammenhängen würde. Unter Berücksichtigung der verfügbaren Literatur gingen wir jedoch davon aus, dass Frauen mehr depressive Erfahrungen als Männer berichten würden (Nolen-Hoeksema, 2001; Van de Velde et al., 2010; Salk et al., 2017) und umgekehrt weniger Selbstwirksamkeit bei der Emotionsregulation (z.B. Freudenthaler und Papousek, 2013) hätten. Eine Beziehung zwischen Umdeutungsfähigkeit und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen erscheint wahrscheinlich, wobei die Selbstwirksamkeit als entscheidende Variable für die tägliche Erfahrung von Depressionen fungieren könnte. In diesem Zusammenhang wurde in früheren Studien eine starke Korrelation zwischen der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit bei der Emotionsregulation und verschiedenen Indikatoren des Wohlbefindens festgestellt (siehe Baudry et al., 2018). Zusätzlich zu den jüngsten Erkenntnissen, dass einige Umdeutungsstrategien (z.B. positive Neubewertungen) möglicherweise besser geeignet sind als andere im Hinblick auf Auswirkungen auf das Wohlbefinden (Kalisch et al., 2015; Willroth und Hilimire, 2016; Perchtold et al., 2018), haben wir Geschlechtsunterschiede in der Qualität der generierten Umdeutungen getestet (positive Neubewertung, Herabsetzung, problemorientierte Umdeutung, Symptom-Neubewertung).