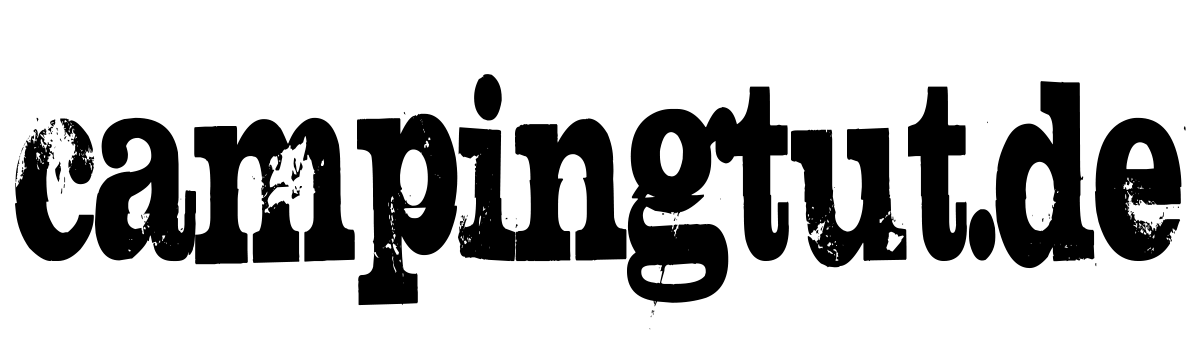In der Altstadt von San Diego, zwischen nachgebauten Wild-West-Saloons, Outdoor-Kneipen und Kakteen-Beeten, steht Martha Rodriguez an der Kasse. In ihrem Shop – mehr eine Hütte als ein Haus – gibt es weder Bier noch Postkarten und auch sonst keine Souvenirs, die man typischerweise mit Kalifornien verbindet. Stattdessen bietet sie handgefertigte Bastkörbe, Tonkrüge, Armbänder und Ohrringe an.
Rodriguez gehört den Kumeyaay an, einem Stamm amerikanischer Ureinwohner, der seit mehreren Jahrtausenden auf dem Gebiet des heutigen Mexikos und der USA siedelt. Sie trägt ein weites, schwarzes Gewand und schaut ernst. „Ich habe in den vergangenen Jahren oft gegen Trumps Grenzmauer protestiert“, sagt die 45-Jährige. „Die Polizisten wissen nicht mal, was ich meine, wenn ich ihnen sage, dass das unser Land ist.“ So geht es vielen Amerikanern, und erst recht den Menschen von außerhalb. Kalifornien – das klingt nach Golden Gate Bridge, nach Sonne, Strand und Surfbrettern.
Die Kultur der Indigenen haben dagegen die wenigsten im Sinn, wenn sie an den bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat denken. Martha Rodriguez hilft ihren Besuchern deshalb gern mit der einen oder anderen Anekdote auf die Sprünge. „Wir waren immer arm, aber reich an Geschichte“, sagt die Ladenbesitzerin, die hauptberuflich als Kulturbeauftragte in einem nahegelegenen Reservat arbeitet.
Wenn sie nicht gerade gegen Grenzmauern demonstriert, unterrichtet sie die Sprache der Kumeyaay oder gibt Kochkurse. Von ihrer Großmutter hat sie gelernt, wie man Zwiebeln, Pilze und Wildkartoffeln in der Natur findet. „Früher“, sagt Rodriguez, „haben mich die Leute komisch angeschaut, wenn ich mein Essen selbst gesammelt habe. In der Pandemie, als alle Läden geschlossen waren, hat plötzlich niemand mehr gelacht.“
Die Kultur der Ureinwohner systematisch ausgelöscht
Der kleine Shop in San Diego ist nicht der einzige Ort, an dem Urlauber in den USA den Natives begegnen. Mal sind es „Handelsposten“ am Straßenrand (oft mit riesigen Wildwest-Pfeilen dekoriert), mal kleinere Museen, hin und wieder werben Plakate für Kajak-Touren mit indigenen Guides. Die Tourismusbehörde von Kalifornien will darauf nun aufbauen. Sie hat eine Million Dollar in das Internetportal „Visit Native California“ investiert, das entsprechende Angebote vorstellt.
Noch gibt es davon nur wenige. Beispiel Gastronomie: Während sich in den USA selbst in Kleinstädten Restaurants jeglicher Couleur tummeln, hat in Kalifornien erst 2018 das erste dezidiert indigene Lokal eröffnet: Das „Café Ohlone“ in der Universitätsstadt Berkeley ist bis heute eine Rarität. Mit „Wahpepah’s Kitchen“ in Oakland, das seit 2021 die Küche der Ureinwohner auftischt, gibt es immerhin ein zweites Restaurant; marinierte Hirschfleischstangen in Apfel-Kirsch-Sauce und Bison-Chili zählen zu den Spezialitäten.
Das mangelnde Angebot hängt auch damit zusammen, dass die Kultur der Ureinwohner bis weit ins 20. Jahrhundert systematisch ausgelöscht wurde – erst mit dem Gewehr, später mit Sprachverboten und Internaten, in denen Kinder die Gepflogenheiten der weißen Mehrheitsgesellschaft lernen mussten. Erst 2019 nahm der Gouverneur von Kalifornien das Wort „Völkermord“ in den Mund. Schwer vorstellbar, dass sich eine solche Historie in ein touristisches Konzept einbinden lässt. Oder doch?
„Bis jetzt haben wir davon nicht viel gemerkt“, sagt Joseph Yeats, 37, Ratsmitglied der Barona, deren Stamm östlich von San Diego beheimatet ist. Mit weißem Hemd und braunen Lackschuhen sieht er aus wie ein x-beliebiger Lokalpolitiker; nur der schwarze Zopf deutet auf seine indigenen Wurzeln hin.
„Im Film laufen immer alle mit Pfeil und Feder herum“, sagt Yeats, „aber die Realität sieht anders aus“. Wie genau, können Besucher im Kulturzentrum der Barona ergründen. Ein Wörterbuch vermittelt die vom Aussterben bedrohte Sprache, Lautsprecher verbreiten Gesänge, daneben eine große Landkarte, die frühere und heutige Siedlungsgebiete gegenüberstellt: Geblieben sind nur wenige Flecken.
Casinos stärken die wirtschaftliche Unabhängigkeit
„Wir kämpfen fortwährend um unsere Rechte“, sagt Yeats und erinnert an die Geschichte der Reservate: „Meist war es wertloses Land, in das die Native Americans verbannt wurden.“ Doch die Zeiten ändern sich, das zu betonen ist Yeats wichtig: „Heute sind wir auf unserem Gebiet eine eigene Nation mit eigener Polizei, eigener Schule und eigener Gesundheitsversorgung. Auf den amerikanischen Staat sind wir nicht angewiesen.“
Möglich macht das ein touristischer Zweig, auf den sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Stämme konzentriert haben: Casinos. Während Glücksspiel in den USA meist verboten ist, unterliegen die Reservate ihrer eigenen Gesetzgebung. Von den Casino-Einnahmen profitieren längst nicht mehr nur die Natives: „Wir haben 400 Stammesmitglieder, aber 1400 Mitarbeiter in unseren Casinos“, sagt Yeats. Plötzlich strahlt er. „Wir sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die ganze Region.“
Eine Frage wird in dem kleinen Museum jedoch nicht beantwortet: Wie stehen die Ureinwohner dazu, „Indianer“ genannt zu werden? Die Kolonisten um Christoph Kolumbus prägten die Bezeichnung einst, als sie irrtümlich glaubten, Indien entdeckt zu haben. Viele Amerikaner sprechen daher lieber von Native Americans; der Begriff First Nations ist ebenfalls gebräuchlich. Verpönt ist das Wort „Indianer“ allerdings nur bei wenigen; manche Stämme bezeichnen sich sogar selbst als „Indians“. Und die Barona? „Mir ist das egal“, sagt Yeats, „solange man uns mit Respekt behandelt.“
Die Agua Caliente bei Palm Springs betreiben ein Luxushotel
Zwei Autostunden entfernt, nahe der Wüstenstadt Palm Springs, hat ein anderer Stamm ebenfalls eine boomende Glücksspiel-Industrie aufgebaut: Die Agua Caliente betreiben nicht nur drei Casinos und eine Tankstelle, sondern auch ein eigenes Luxushotel, das „Agua Caliente Resort“. Von indigener Kultur ist dort erst einmal nichts zu sehen. Stattdessen ein Swarovski-Geschäft, goldene Aufzüge und blinkende Spielautomaten, einige direkt neben der Rezeption.
Wer im Zimmer den Fernseher einschaltet, sieht eine Hotel-Mitarbeiterin, die die einzelnen Glücksspiele erklärt. Das eigentliche Spektakel spielt sich vor dem Fenster ab, über dem Land der Agua Caliente: Die Sonne taucht die Wüste in ein mystisches orangefarbenes Licht, im Hintergrund hängen malerische Wolken im Felsmassiv.
Ortstermin bei Reid Milanovich, dem Vorsitzenden der Agua Caliente. Der junge Mann – gegelte Haare, graue Stoffhose, weißes Hemd – sitzt vor einer Dose Red Bull. Sein Amtssitz ist ein verglastes Bürogebäude mit Wachmann und Sitzgruppe in der Lobby. Milanovich redet nicht lange um den heißen Brei: „Die Casinos sind für uns ein Mittel zum Zweck. Ohne Einnahmen könnten wir unsere Selbstverwaltung nicht aufrechterhalten.“
Gleichzeitig setzt er auf Menschen, die sich wirklich für die Natives interessieren, für ihre alte Kultur, ihre Naturverbundenheit. „Das sind zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen. Beide haben ihre Berechtigung.“
Die neue Zielgruppe soll im „Agua Caliente Plaza“ bedient werden. Mitten in Palm Springs entsteht ein Museum mit Wasserläufen und angeschlossenem Wellnessbereich. Beim Blick durch den Bauzaun zeigt sich ein liebevoll gestaltetes Areal samt Palmengarten und indigenen Ornamenten. Mehrfach wurde der Eröffnungstermin verschoben, im November 2023 soll es nun so weit sein.
Milanovich lässt sich von den Verzögerungen nicht aus der Ruhe bringen. „Wir wollen es nicht irgendwie machen“, sagt er, „sondern richtig.“ Bei den Bauarbeiten seien zum Beispiel jahrtausendealte Artefakte gefunden worden. „Die zu sichern, hatte Priorität. Da werde ich ganz emotional, wenn ich daran denke.“
Plötzlich ist man mittendrin in der Welt der Natives
Am nächsten Morgen gibt ein Ranger der Agua Caliente eine Führung durch den nahegelegenen Tahquitz-Canyon: Wüstenblumen, schroffe Felsen, Quellwasser, dem die Natives eine heilende Wirkung nachsagen. Das Gebiet rund um den Canyon gehört den Indigenen, sie haben ein modernes Besucherzentrum gebaut, um Urlaubern ihr heiliges Land zu erklären. Die Tour ist beliebt; schon bei der ersten Führung um 10 Uhr morgens ist der Parkplatz fast voll.
Schnell geht es nicht nur um die Schönheit der Natur, sondern um essenzielle Fragen: Klimawandel, Wasserknappheit, die Rolle des Menschen in der Natur. Die Besuchergruppe löchert den Ranger, der mit Halstuch und Sonnenbrille wie ein geborener Abenteurer aussieht. Zu den Agua Caliente gehört er allerdings nicht – auch die Natives beschäftigen externe Mitarbeiter, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Und plötzlich ist man mittendrin in der Welt der Natives. Weder Casino noch Museum, sondern einfach Natur. In jener Umgebung, die den Indigenen so wichtig war und ist, als Jagdgrund, als spiritueller Ort, als Ursprung allen Lebens. Hier kann man am ehesten ermessen, was die Kultur der Ureinwohner ausmacht – und dass das, was davon noch übrig ist, unbedingt geachtet werden sollte.
Tipps und Informationen für Kalifornien:
Anreise: Von Frankfurt fliegen zum Beispiel Lufthansa, Condor oder United nonstop nach Los Angeles. Weiter per Mietwagen. Die Region zwischen San Diego und Palm Springs war von den Wald- und Buschbränden, die 2023 in Teilen Kaliforniens wüteten, nicht betroffen.
Indigene Kultur: Das Barona Cultural Center & Museum in Lakeside ist geöffnet donnerstags, freitags und sonntags, Eintritt frei. Der Shop von Martha Rodriguez in San Diego öffnet nur freitags bis sonntags (10-17 Uhr). Geführte zweistündige Touren auf indigenen Spuren im Tahquitz-Canyon werden mehrmals täglich angeboten, Eintritt zum Canyon: 15 US-Dollar (14 Euro).
Unterkunft: „Agua Caliente Resort“ in Rancho Mirage, Doppelzimmer ab 239 Euro. In San Diego haben die Kumeyaay 2003 „The US Grant“ gekauft und saniert, es zählt zur Luxury Collection von Marriott, Doppelzimmer ab 329 Euro. „Cache Creek“ im Capay Valley, Hotel mit Golfclub und Casino der Yocha-Dehe-Wintun-Nation, Doppelzimmer ab 250 Euro.
Weitere Infos: visitcalifornia.com/native/
Die Teilnahme an der Reise wurde unterstützt von Visit California. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter axelspringer.com/de/werte/downloads.